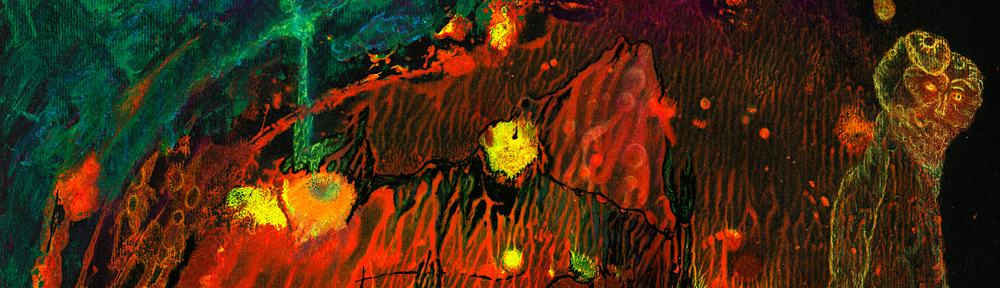Kant, Immanuel, der einflußreichste Philosoph neuerer Zeit, geb. 22. April 1724 zu Königsberg i. Pr. als Sohn eines Sattlermeisters, dessen Familie einer Tradition zufolge aus Schottland stammte, erhielt den ersten gelehrten Unterricht auf dem Collegium Fridericianum, seit 1740 an der Universität seiner Vaterstadt, wo er mit besonderm Eifer Mathematik (unter dem Wolfianer Knutzen), Physik und Philosophie studierte. Die Frucht des Studiums von Newtons Werken war Kants erste Schrift: „Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte“ (Königsb. 1747). Nachdem er Jahre hindurch als Hauslehrer thätig gewesen war, erwarb er 1755 durch eine Dissertation: „De igne“, die Doktorwürde und in demselben Jahr durch die Verteidigung seiner Abhandlung „Principiorum primorum cognitionis metaphysicae novae dilucidatio“ die Venia legendi. Naturwissenschaften, besonders Astronomie und Geographie, bildeten sein Lieblingsstudium; in seiner „Allgemeinen Naturgeschichte und Theorie des Himmels“ (Königsb. 1755) antizipierte er die spätere Laplacesche Theorie der Entstehung unsers Sonnensystems. Sein philosophischer Standpunkt war in dieser Periode noch der Wolfsche; daneben studierte er fleißig englische Philosophen, insbesondere Hutcheson und Hume, dessen Skeptizismus ihn zwar ansteckte, den er aber in seiner dritten Periode überwinden sollte. Die Wirkungen jenes Studiums zeigen sich in den Schriften seiner zweiten empiristischen Periode, zu welchen „Der einzige mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes“ (1765), die von Burke beeinflußten „Betrachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen“ (1764), die „Träume eines Geistersehers, erläutert durch Träume der Metaphysik“ (1762) und besonders seine Preisschrift für die Berliner Akademie der Wissenschaften: „Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral“ (1763), gehören. Erst nachdem er 15 Jahre lang Privatdozent gewesen war und Rufe nach Erlangen und Jena aus Liebe zur Heimat ausgeschlagen hatte, ward ihm 1770 die ordentliche Professur der Logik und Metaphysik zu teil, die er mit der Verteidigung der Dissertation „De mundi visibilis atque intelligibilis forma et principiis“ eröffnete. In derselben war die Wurzel seiner eignen Philosophie, die transzendentale Ästhetik, und damit die Kritik der reinen Vernunft gleichsam als Programm und in nuce enthalten, so daß diese wichtige Schrift als Beginn seiner dritten, den Skeptizismus Humes wie vorher den Dogmatismus Wolfs hinter sich lassenden Periode betrachtet werden kann. Dennoch währte es noch mehr als zehn Jahre, ehe sein lange überlegtes, zuletzt in dem kurzen Zeitraum von vier Monaten niedergeschriebenes Hauptwerk: „Die Kritik der reinen Vernunft“ (1781, 2. veränderte Aufl. 1787), ans Tageslicht trat, welchem in kurzen Zwischenräumen die übrigen Hauptwerke: 1783 die „Prolegomena zu einer künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können“, 1785 die „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, 1786 die „Metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaften“, 1788 die „Kritik der praktischen Vernunft“, 1790 die „Kritik der Urteilskraft“, 1793 die „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“, 1797 die „Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre“ und die „der Tugendlehre“, 1798 „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“, nachfolgten. Kleinere Abhandlungen waren: „Über die Verschiedenheit der Menschenrassen“ (1775); „Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht“, „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ (beide 1784); die großes Aufsehen erregende „Rezension von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit“ von 1785, welche Herder so übel aufnahm, daß er seitdem den vertrautern Verkehr mit K. vermied; die beiden Abhandlungen: „Über die Vulkane im Mond“ und „Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks“ (gleichfalls 1785); „Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte“; „Was heißt sich im Denken orientieren?“; „Bemerkungen zu Jacobis Prüfung der Mendelssohnschen Morgenstunden“ (1786), „Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie“ (1788); „Über Schwärmerei und die Mittel dagegen“ (1790); „Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee“ (1791); „Über die Fortschritte der Metaphysik seit Leibniz und Wolf“ (aus demselben Jahr); „Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ (1793); „Etwas über den Einfluß des Mondes auf die Witterung“, „Das Ende aller Dinge“, „Über Philosophie überhaupt“ (sämtlich von 1794); „Zum ewigen Frieden, ein philosophischer Entwurf“ (1795); „Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie“, „Verkündigung eines nahen Abschlusses eines Traktats zum ewigen Frieden in der Philosophie“ (beide 1796); „Über ein vermeintes Recht, aus Menschenliebe zu lügen“, in welcher K. als strenger Wahrheitsfreund die Notlüge unbedingt verwirft, „Der Streit der Fakultäten“, „Von der Macht des Gemüts, durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu sein“ (sämtlich 1798). Aus einem angeblich in Kants Nachlaß vorgefundenen Manuskript: „Vom Übergang von der Metaphysik zur Physik“, haben neuerlich Reicke und A. Krause Bruchstücke und Auszüge veröffentlicht.
Kants System erregte bald nach dem Erscheinen der ersten Hauptwerke in allen Teilen Deutschlands, auch in den katholischen, sowie im Ausland, insbesondere in England und in den Niederlanden, Sensation. Dagegen witterte man in seinem Vaterland Preußen nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms II., als der freisinnige Minister v. Zedlitz durch den vormaligen Prediger Wöllner (1788), den Urheber des Religionsedikts, ersetzt worden war, in K. einen gefährlichen Neuerer. Nach der Herausgabe seiner „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ erschien 1794 eine Kabinettsorder, welche deren Verfasser wegen „Entstellung und Herabwürdigung des Christentums“ einen Verweis erteilte und allen theologischen und philosophischen Dozenten der Königsberger Universität untersagte, über jenes Werk Vorlesungen zu halten. Dieser Gewaltstreich hatte zur Folge, daß K. teilweise, seit 1797 gänzlich seine Vorlesungen einstellte und sich in seinen letzten Lebensjahren fast ausschließlich mit der Ordnung seiner Papiere beschäftigte, bei welcher er sich durch jüngere Kräfte, wie Rink und Jäsche, unterstützen ließ. Nachdem in seinem letzten Lebensjahr Altersschwäche eingetreten war, starb er 12. Febr. 1804. Sein Kopf wurde vom Professor Knorr in Gips abgeformt. K. war von Person klein, kaum 5 Fuß groß, von schwachem Knochenbau und noch schwächerer Muskelkraft; seine Brust war sehr flach und fast eingebogen, der rechte Schulterknochen hinterwärts etwas verrenkt, womit der Befund bei der 1880 erfolgten Ausgrabung und Wiederbestattung übereinstimmt. (Vgl. Bessel-Hagen, Die Grabstätte Kants, Königsb. 1880.) Sein sanftes blaues und doch lebhaftes Auge zog unwiderstehlich an. Sein Gemüt wird von seinen Freunden mit voller Übereinstimmung als ein kindliches bezeichnet. Den öffentlichen Gottesdienst hielt er, wie das Äußere der Religion überhaupt, für ein höchst wichtiges, dem Denker aber entbehrliches Staatsinstitut. Zum kunstgerechten Redner war er nicht gemacht; in sozialer und politischer Hinsicht war er ein entschiedener Vertreter der Freiheit, unterwarf sich jedoch in der politischen Ordnung den Befehlen der Obrigkeit, selbst gegen seine bessere Überzeugung. Das Gesetz der Ordnung dehnte er selbst auf die Formen des geselligen Lebens aus; in seinem Hauswesen herrschte neben solider Einfachheit die größte Regelmäßigkeit. Durch Orden und Titel ist K. nicht ausgezeichnet worden; die Berliner Akademie der Wissenschaften ernannte ihn 1763 zu ihrem Mitglied, die Petersburger that dasselbe 1794. Das gelungenste Porträt Kants ist das von Döbler 1791 gefertigte Ölgemälde. Am 18. Okt. 1864 ward in Königsberg sein Standbild, das letzte Werk Rauchs, errichtet. An dem von K. seit 1783 bis zu seinem Tod bewohnten eignen Haus, unfern dem Schloß in der Prinzessinstraße, wurde in neuerer Zeit eine Inschrifttafel angebracht. Gesamtausgaben seiner Werke sind die von G. Hartenstein (Leipz. 1838-39, 10 Bde.), von K. Rosenkranz und F. W. Schubert (das. 1838-40, 12 Bde.), die beste „in chronologischer Folge“ von G. Hartenstein (das. 1867-69, 8 Bde.), neben welchen noch die von Kirchmann (Leipz. 1874, 8 Bde. und Supplement, mit Erläuterungen) zu nennen ist. Eine brauchbare Ausgabe der Hauptschriften besorgte Kehrbach (in Reclams „Universalbibliothek“). Auch sind mehrere Schriften Kants ins Lateinische, Französische (von Tissot, Barni) und Englische (von Hayward, Abbott, Max Müller u. a.) übersetzt worden. Das Leben Kants haben geschildert: Borowski, Darstellung des Lebens und Charakters Kants (Königsb. 1804); Wasianski, K. in seinen letzten Lebensjahren (das. 1804); Jachmann, I. K., geschildert in Briefen (das. 1804); Schubert (im 11. Bd. der genannten Gesamtausgabe); Reicke, Kantiana (das. 1860); Saintes, Histoire de la vie et de la philosophie de K. (Par. 1844; Stuckenberg, The life of Imman. K. (Lond. 1882); Arnoldt, Kants Jugend und die fünf ersten Jahre seiner Privatdozentur (Königsb. 1882).
Kants Philosophie.
K. selbst bezeichnete seine Philosophie als Kritizismus und setzte sie einerseits der Wolfschen, die er Dogmatismus, anderseits der Humeschen, die er Skeptizismus nannte, entgegen. Im Gegensatz zu jenem, welcher der menschlichen Vernunft die Fähigkeit, jenseit der sinnlichen Erfahrung gelegene Gegenstände zu erkennen, zu-, und zu diesem, welcher selbst der Erfahrung Allgemeingültigkeit absprach, behauptete K., daß nur innerhalb der Erfahrung gelegene Gegenstände, diese aber mit Allgemeingültigkeit erkannt würden. Durch erstere Behauptung setzte K. dem menschlichen Erkenntnisvermögen eine nicht zu überschreitende Grenze; durch die letztere sicherte er demselben innerhalb dieser Anspruch auf allgemeine Anerkennung. Beide gründete er auf eine Untersuchung nicht der Erkenntnis, sondern des Erkenntnisvermögens, da von der Beschaffenheit des letztern als des Organs der Erkenntnis die Beschaffenheit der möglichen Erkenntnis notwendig abhängen muß. Wie das Auge nur sieht, was und wie seine Struktur es gestattet, so erkennt das Erkenntnisvermögen nur, was und wie seine innere Organisation es erlaubt. Zeigt sich, daß dasselbe auf die Erkenntnis solcher Gegenstände, die jenseit der sinnlichen Wahrnehmbarkeit liegen, gar nicht angelegt ist, so wäre es eitler Wahn, von ihm eine Erkenntnis solcher zu erwarten. Eine derartige, auf die Tragweite des Erkenntnisvermögens, statt auf den Inhalt der (wirklichen oder vermeintlichen) Erkenntnis, gerichtete Prüfung nun nannte K. kritisch und diejenigen Gegenstände welche infolge derselben außerhalb des Gesichtskreises der menschlichen Erkenntnis fallen, transzendent. Gerade diejenigen Objekte der Erkenntnis, welche nach Wolf den eigentlichen Inhalt der theoretischen Philosophie (Metaphysik) und ihrer drei Hauptzweige, Psychologie, Kosmologie und Theologie, ausmachten: Seele, Welt und Gott, wurden infolge der Kantschen Kritik der Vernunft transzendent, d. h. fielen über die Grenze reiner Vernunfterkenntnis hinaus. Und zwar aus folgendem Grunde: Da alles Erkennen im Urteilen besteht, so hängt die Möglichkeit des erstern notwendig von der Beschaffenheit des letztern ab. Nun ist aber jedes Urteil, welches ja in nichts anders als in der Aussage eines Prädikats von einem Subjekt besteht, entweder von der Art, daß das Prädikat im Subjekt schon ganz oder teilweise enthalten (ganze oder teilweise Wiederholung des Subjekts) ist, oder derart, daß das Gegenteil der Fall ist, das Prädikat zum Subjekt etwas Neues hinzubringt. Urteile ersterer Art nennt K. (wie vor ihm schon Hume) analytische, letzterer Art synthetische, jene auch bloße Erläuterungs-, diese dagegen Erweiterungsurteile. Erstere sind zwar richtig, aber nicht wichtig, letztere dagegen, da auf ihnen aller Fortschritt im Wissen beruht, höchst wichtig, aber, wenn nicht bekräftigende Umstände hinzutreten, von zweifelhafter Richtigkeit. Da in denselben das Prädikat zum Subjekt hinzukommt, ohne in demselben enthalten zu sein, so muß irgend ein äußeres Zeugnis gegeben sein, daß dem Subjekt dieses Prädikat auch wirklich angehört. Ein solches liegt, wo der Gegenstand ein sinnlich wahrnehmbarer ist, im Augenschein, d. h. in der sinnlichen Anschauung, welche Subjekt und Prädikat verbunden zeigt: „die Rose ist rot“. Solche synthetische Urteile nennt K. a posteriori, weil sie durch eine sinnliche Anschauung bekräftigt sind. Wo dagegen der Gegenstand kein sinnlich wahrnehmbarer ist, da ist keine Überzeugung durch Augenschein möglich, und solche Urteile (mit Ausnahme der mathematischen), die K. synthetisch a priori nennt, bleiben notwendig ungewiß. Bis hierher war daher K. mit dem Skeptizismus Humes, welcher ihn, wie er selbst sagt, aus seinem „dogmatischen Schlummer“ erweckt hatte, vollkommen einverstanden; ja, er ging sogar noch weiter als dieser. Da nämlich die Gegenstände der Mathematik auch keine sinnenfälligen sind (da es keine reine Gerade, keinen reinen Kreis etc. gibt), so entstand die Frage, wie eine Erkenntnis derselben möglich sei. Hume fand darin keine Schwierigkeit, da seiner Ansicht nach die mathematischen Erkenntnisse analytische Urteile, K. aber die größte, da dieselben ihm zufolge synthetische Urteile sind. Da nun bei solchen die Verknüpfung von Subjekt und Prädikat nur durch eine Anschauung sicher festgestellt werden kann, von mathematischen Objekten aber, als nicht sinnenfälligen, eine sinnliche Anschauung nicht möglich ist, so mußten (im Fall es keine andre als sinnliche Anschauung gibt, wie der Empirismus behauptet) auch die mathematischen Erkenntnisse ungewiß werden. Letzteres dünkte K., der von der Unerschütterlichkeit der Mathematik als Wissenschaft überzeugt war, unerträglich, und er ging darauf aus, zunächst Mathematik als Wissenschaft (von seinem, nicht von Humes Standpunkt aus) wieder möglich zu machen.
Damit beginnt die positive Seite seiner Kritik der reinen Vernunft, in welcher er gegen den Skeptizismus reagiert, während die negative Seite darin bestanden hatte, daß er (mit Hume) gegen den Dogmatismus reagierte. Das Ergebnis der letztern bestand darin, daß eine wirkliche Erkenntnis nur von anschaulichen Gegenständen, also (ganz wie die Empiristen lehrten) nur durch Erfahrung möglich sei; jenes der erstern dagegen gipfelte in dem Satz, daß in der Erfahrung selbst mehr als „bloße Erfahrung“ enthalten sei. Es sei zwar richtig, lehrt K., daß unsre gesamte Erkenntnis mit der Erfahrung anhebe, keineswegs aber, daß sie nur aus der Erfahrung stamme. Wäre das letztere, wie die englischen Empiristen behaupteten, wirklich der Fall, so wäre, da alle aus der Erfahrung geschöpften Urteile nur „komparative“ (induktive) Allgemeinheit besitzen können, eine „apriorische“ (ausnahmslose) Allgemeinheit, wie sie z. B. die mathematischen Urteile besitzen müssen, unmöglich. Es muß daher in der Erfahrung selbst ein „apriorisches“ (von aller Erfahrung unabhängiges) Element geben, durch welches diese wirkliche Allgemeinheit erlangt, also erst dieses Namens vollkommen würdige Erfahrung wird. Die auf die Entdeckung dieses von aller Erfahrung unabhängigen, aber zugleich aller Erfahrung zu Grunde liegenden (apriorischen) Elements gerichtete Untersuchung nennt K. transzendental und, insofern seine Kritik sich mit solcher beschäftigt, dieselbe Transzendentalphilosophie. Da dasselbe von aller Erfahrung unabhängig (vor der Erfahrung als „Prius“ derselben) ist, so wird es von dem erfahrenden Subjekt (und zwar von jedem Individuum der Menschheit auf gleiche Weise) zu dem von der Erfahrung abhängigen Elemente der Erfahrung hinzugebracht, so daß jenes den invariabeln, dieses dagegen den variabeln Faktor der Erfahrung, als beider Produkt, ausmacht. Jenen, den apriorischen Faktor, der aus dem Subjekt (dem Träger des allen menschlichen Individuen gemeinsamen a priori-Elements, der deshalb auch transzendentales Subjekt heißt) stammt, nennt K. die Form, diesen, den aposteriorischen Faktor, der einem uns nur durch seine in uns hervorgebrachten Wirkungen (die Sinnesempfindungen) bekannt werdenden Objekt (dem Ding an sich) entstammt, die Materie aller Erfahrung. Erstere, weil dem Subjekt angehörig, macht das idealistische, letztere, weil auf ein (von diesem verschiedenes) Objekt bezogen, das realistische Element von Kants Philosophie aus, an welche beiden nachher die entgegengesetzten Richtungen seiner (idealistischen: Fichte, Schelling, Hegel, und realistischen: Herbart, Schopenhauer) Nachfolger angeknüpft haben. Das idealistische wird in der 1. Auflage seiner Kritik, wo es ihm vornehmlich darum zu thun ist, gegen Hume die Theorie einer allgemeingültigen und notwendigen Erfahrung durchzusetzen, das realistische dagegen in der 2. Auflage betont, wo es ihm darum zu thun ist, sich von dem Verdacht eines das Sein überhaupt aufhebenden Idealismus (wie der Berkeleys) zu reinigen. Die positive Seite der Kritik der reinen Vernunft ist nur der Aufdeckung der apriorischen Elemente des Erkenntnisvermögens gewidmet, welcher er später in der Kritik der praktischen Vernunft und in der Kritik der Urteilskraft die Aufdeckung des im Begehrungs- und (nach Wolfscher Terminologie) Gefühlsvermögen enthaltenen a priori folgen ließ. Seine Absicht war dabei, ein „Inventarium“ dessen zu liefern, was (jederzeit und von jedermann) mit Allgemeinheit und Notwendigkeit (theoretisch) erkannt, (praktisch) gewollt und (ästhetisch) wohlgefällig und mißfällig empfunden wird. Zu diesem Zweck werden in der Kritik der reinen Vernunft die drei Teile des Erkenntnisvermögens (nach Wolfscher Terminologie): niederes und höheres oder: Sinn, Verstand, Vernunft, nacheinander vorgenommen und auf die apriorischen Bestandteile, welche in denselben enthalten sein mögen, geprüft. Da zeigt es sich nun, daß beide letztern zwar durchaus apriorisch sind, aber (mit Ausnahme des Daseins des Dinges an sich) von außerhalb des Kreises der sinnlichen Erscheinung gelegenen Dingen keine Erkenntnis gewähren; ferner, daß der Sinn zwar allgemeine und notwendige Erkenntnis gewährt, aber nur, weil und soweit auch in ihm „apriorische“ (also nicht aus der Erfahrung, sondern aus dem transzendentalen Subjekt stammende) Elemente enthalten sind.
Als solche wurden von K. die sogen. reinen Anschauungsformen des Raums (das Neben-) und der Zeit (das Nacheinander) bezeichnet. Mittels derselben werden vom wahrnehmenden Subjekt räumliche und zeitliche Anordnung in das Chaos sinnlicher Empfindungen (des Auges, des Ohres etc., welche zusammen die „Materie“ unsrer Erfahrung ausmachen) „hineingeschaut“ und dieses dadurch in eine Welt räumlich und zeitlich verbundener und geschiedener Erscheinungen verwandelt. Letztere machen daher das eigentliche Objekt des Sinnes, den Gegenstand des sinnlichen Anschauungsvermögens, aus, und durch die auf diesem Wege gewonnenen sinnlichen Anschauungen wird dem sonst ganz leeren Verstand Stoff zu weiterer Verarbeitung geliefert. Dieses sinnliche Anschauen als Funktion des Sinnes ist zugleich auch diejenige, welche sinnliche Erkenntnis durch synthetisch-aposteriorische Urteile möglich macht, indem sie die zur Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt nötige sinnliche Anschauung liefert. Das reine Anschauen, diejenige Funktion des Sinnes, durch welche das „Hineinschauen“ der Räumlichkeit und Zeitlichkeit in die Empfindungswelt vollzogen wird, dagegen ist diejenige, welche mathematische Erkenntnis durch synthetisch-apriorische Urteile möglich macht, indem sie die zur Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt nötige Anschauung, welche hier, wo es sich um nichtsinnenfällige Objekte handelt, keine sinnliche sein darf, liefert. Eine solche ist die sogen. reine Anschauung des Raumes, welche die Evidenz der geometrischen, und jene der Zeit, welche die Evidenz der arithmetischen Erkenntnisse vermittelt. Demjenigen Abschnitt der Kritik, in welchem es sich um die Entdeckung der apriorischen Elemente der Sinnlichkeit (Raum und Zeit) handelt, hat K. deshalb den Namen: „transzendentale Ästhetik“ gegeben. Die nächste Folge aus dieser von K. behaupteten „Idealität“ von Raum und Zeit ist nun die, daß beide, als bloße Anschauungsformen des (transzendentalen) Subjekts, auf das, was unabhängig von diesem ist, das Ding an sich, keine Anwendung finden können und sich daher nichts, was auf Räumlichkeit und Zeitlichkeit bezüglich ist (z. B. Grenzen im Raum, Anfang in der Zeit), von diesem behaupten oder leugnen läßt. Unsre gesamte Erkenntnis bleibt auf die Erscheinungswelt (phaenomenon im Gegensatz zur „intelligibeln“, noumenon, unter welcher das Ding an sich verstanden wird) beschränkt, deren räumliche sowohl als zeitliche Ausdehnung und Gestaltung eben erst durch die Thätigkeit des räumlichen und zeitlichen Anschauens zu stande kommt. Wie letztere beiden die apriorischen Funktionen des Sinnes, so stellen zwölf ursprüngliche Urteilsformen die ebensolchen des Verstandes und drei ursprüngliche Schlußformen diejenigen der (theoretischen) Vernunft dar. Wie durch die erstgenannten die unverbundenen Sinnesempfindungen räumlich und zeitlich zu Anschauungen, so werden durch die verschiedenen Verstandesfunktionen die unverbundenen Sinnesvorstellungen in ebenso vielfacher Weise zu Begriffen und durch die verschiedenen Schlußfunktionen die unverbundenen Verstandesbegriffe in ebenso vielfacher Weise zur Einheit, zu Ideen zusammengefaßt. Jeder der beiden apriorischen Sinnesfunktionen entspricht daher eine reine Anschauungsform, jeder der zwölf apriorischen Verstandesfunktionen ein reiner Verstandesbegriff (Stammbegriff, Kategorie), jeder der drei apriorischen Vernunftfunktionen eine reine Vernunftidee. Als erstere zählt K. Raum und Zeit auf; als Kategorien: Allheit, Vielheit, Einheit, welche der Quantität, Position, Negation, Limitation, welche der Qualität, Substanz und Inhärenz, Kausalität, Wechselwirkung, welche der Relation, Wirklichkeit, Möglichkeit, Notwendigkeit, welche der Modalität unterstehen; als Ideen: die der Seele, welche der kategorischen, der Welt, welche der hypothetischen, der Gottheit, welche der disjunktiven Schlußform entsprechen. Die Deduktion der Kategorien als apriorischer Verstandes- und die der Ideen als apriorischer Vernunftfunktionen bildet zusammen die transzendentale Logik, die wieder in die transzendentale Analytik (Verstandes-) und transzendentale Dialektik (Vernunftlehre) zerfällt. Die Ideen der letztern („transzendentale Vernunftideen“) haben nur regulative, nicht konstitutive Bedeutung, da jeder Versuch, ihnen eine solche beizulegen, auf unlösbare Schwierigkeiten stößt. Der Schluß von der Idee der Seele auf deren Existenz ist ein „zwar unvermeidlicher“, aber nichtsdestoweniger ein Fehlschluß („Paralogismus der reinen Vernunft“). Der Versuch, der Idee der Welt Realität beizulegen, führt unter jedem der vier möglichen Hauptgesichtspunkte auf eine Antinomie, d. h. auf ein Paar einander ausschließender Gegensätze, von denen jeder sich mit gleich guten Gründen bejahen und verneinen läßt, z. B.: die Welt hat einen Anfang in der Zeit und Grenzen im Raum, und: sie hat beides nicht. Die für die Realität der Gottesidee möglichen oder doch wenigstens bisher versuchten Beweise: der ontologische, kosmologische und physiko-teleologische, sind sämtlich irrig, da sich weder aus dem „Gedanken“ des allerrealsten Wesens dessen „Sein herausklauben“, noch aus der unendlichen Reihe von Ursachen auf eine erste Ursache oder von der Zweckmäßigkeit des kleinen überschaubaren Teils des Weltgebäudes auf dessen Zweckmäßigkeit im Ganzen mit Sicherheit schließen läßt. Dieses Ergebnis der Kritik der reinen Vernunft, welches von der gesamten Welt der sinnlichen und übersinnlichen Dinge als der Erkenntnis zugängliches Objekt nur das raum- und zeitlose Ding an sich und auch dieses nur nach seiner (durch den, wie Fichte zeigte, inkonsequenten Schluß von der Wirkung auf die Ursache verbürgten) Existenz, nicht nach seiner (uns gänzlich unbekannt bleibenden) Qualität übrigläßt, ist es, welches K. bei seinen Zeitgenossen den Beinamen des „Alleszermalmers“ verschafft hat. In seinen spätern Schriften (schon in der „Kritik der praktischen Vernunft“) hat er dies, besonders was die Gegenstände der sogen. natürlichen Religion betrifft, teilweise durch die von ihm erfundene „Postulierungsmethode“ wieder gutzumachen gesucht. Wie die Kritik der reinen Vernunft auf die Entdeckung des a priori im Erkenntnis-, so geht die der praktischen auf die Auffindung des a priori im Begehrungsvermögen aus. Wie ohne Allgemeinheit und Notwendigkeit kein wirkliches Wissen, so ist ohne Allgemeingültigkeit kein wirklich tugendhaft zu nennendes Wollen möglich. Das Wollen, welches als gut allgemein anerkannt werden soll, muß daher von der Beschaffenheit sein, daß seine Maxime fähig ist, ohne Widerspruch als allgemeines Gesetz aufgestellt zu werden. Daraus erhellt, daß die Lust oder der eigne Vorteil niemals als Prinzip einer Sittenlehre gelten kann, weil sowohl jene als dieser nur individuelle Geltung besitzen. K. verwirft praktisch den Eudämonismus aus demselben Gesichtspunkt, aus welchem er theoretisch den Skeptizismus bestreitet. Wie nicht der Inhalt, sondern die Form der Erfahrung (ihre Allgemeinheit und Notwendigkeit) entscheidet, ob sie als solche wahr sei, so entscheidet nicht der Inhalt, sondern die Form (die Allgemeingültigkeit der Maxime) des Wollens, ob es als solches gut sei. Das sittliche Wollen schließt jedes andre Motiv als die erkannte Pflichtmäßigkeit aus; der kategorische Imperativ, wie K. die Forderung des Sittengesetzes bezeichnete, ist unbedingt, ein Sollen, das von jeder Rücksicht auf Sein oder Seinkönnen unabhängig ist.
Durch diese Reinheit der sittlichen Triebfedern, dem von Frankreich aus eingedrungenen Eudämonismus und Hedonismus gegenüber, hat K. reinigend und erhebend auf seine Zeitgenossen und Nachkommen gewirkt. Seine Abneigung gegen die Glückseligkeit als Beweggrund der Sittlichkeit war so groß, daß selbst Schiller fand, Kants Rigorismus „schrecke die Grazien zurück“. Geschieht eine Handlung zwar dem Gesetz gemäß, aber nicht rein um des Gesetzes willen, so ist bloße Legalität, nicht Moralität vorhanden. Als höchstes Gut, nach welchem der Mensch strebt oder streben soll, ist Tugend und Glückseligkeit, in höchster Potenz und innigster Kausalverbindung gefaßt, zu betrachten. Da nun die sinnliche Welt weder die Tugend in ihrer Vollendung, noch die Glückseligkeit in ihrer höchsten Potenz gewährt, noch auch beide hier immer verbunden vorkommen, so macht die praktische Vernunft folgende Postulate: Zur Erreichung der höchsten Tugend wird die Unsterblichkeit gefordert, zur Verwirklichung der Verbindung der höchsten Glückseligkeit mit der vollendetsten Tugend, d. h. zur Realisierung des höchsten Gutes, aber ist das Dasein Gottes notwendige Bedingung. Wenn also das höchste Gut verwirklicht werden soll, so muß die Unsterblichkeit der Seele und mit ihr ein unendliches Fortschreiten zu höherer Vollendung und Heiligkeit vorausgesetzt werden; es muß ferner ein Wesen geben, das die gemeinsame Ursache der natürlichen und sittlichen Welt ist und Tugend und Glückseligkeit in ein entsprechendes Verhältnis zu setzen vermag, das demnach auch unsre Gesinnungen kennt, absolute Intelligenz besitzt und nach dieser Intelligenz uns die Glückseligkeit zuteilt. Ein solches Wesen ist aber Gott. So entwickeln sich aus der praktischen Vernunft nicht nur die Idee der Unsterblichkeit und die Idee Gottes, sondern auch die Idee der Freiheit. Diese leitet ihre Realität ab aus der Möglichkeit des moralischen Gesetzes überhaupt; die Idee der Unsterblichkeit entlehnt ihre Realität aus der Möglichkeit der vollendeten Tugend, die Idee Gottes aus der notwendigen Forderung vollendeter Glückseligkeit. Diese drei Ideen, unlösbare Aufgaben für die theoretische, gewinnen Boden im Gebiet der praktischen Vernunft. Auch jetzt aber sind sie nicht theoretische Dogmen, sondern praktische Postulate, notwendige Voraussetzungen des sittlichen Handelns. Diesen Ansichten entsprechen auch die Grundsätze über Religion, welche K. in der Schrift „Religion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft“ niedergelegt hat. Der Grundgedanke ist hier die Zurückführung der Religion auf Moral. Je reifer die Vernunft wird, je mehr sie den moralischen Sinn für sich festhalten kann, um so entbehrlicher werden die statutarischen Satzungen des Kirchenglaubens. Wie die beiden vorangegangenen Kritiken die apriorischen Elemente des Erkenntnis- und Begehrungsvermögens, so deckte die dritte, die Kritik der Urteilskraft, jene des Mittelglieds zwischen beiden, des Gefühlsvermögens oder, wie K. es nennt, der Urteilskraft, auf. Gegenstand dieser letztern ist der Begriff der Zweckmäßigkeit der Natur und zwar sowohl der ästhetischen als der teleologischen Zweckmäßigkeit. Die ästhetische Zweckmäßigkeit, welche die Dinge subjektiv für uns haben, entfaltet sich in den Begriffen des Schönen und des Erhabenen; die teleologische Zweckmäßigkeit bezieht sich auf das Verhältnis der Dinge unter sich und ist entweder eine äußere und zufällige oder eine innere, in dem Organismus des Dinges bedingte und notwendige. Ob der Natur an und für sich innere Zweckmäßigkeit zukomme oder nicht, können wir nicht bestimmen; wir behaupten nur, daß unsre Urteilskraft die Natur als zweckmäßig ansehen müsse. Wir schauen den Zweckbegriff in die Natur hinein, indem wir gänzlich dahingestellt sein lassen, ob nicht vielleicht ein andrer Verstand, der nicht denkt wie der unsrige, zum Verständnis der Natur den Zweckbegriff gar nicht nötig hat. Gäbe es einen Verstand, welcher im Allgemeinen das Besondere, im Ganzen die Teile mit Bestimmtheit erkennen könnte, so würde ein solcher die ganze Natur aus einem Prinzip begreifen, den Begriff des Zweckes nicht brauchen.
Kants Hauptwerk blieb einige Jahre hindurch ziemlich unbeachtet, bis die ebenso klar wie anziehend geschriebenen „Briefe über die Kantsche Philosophie“ von Reinhold (s. d.), welche zuerst (seit 1786) in Wielands „Deutschem Merkur“ erschienen, die Denker- und Leserwelt für den Verfasser gewannen. Als Gegner Kants traten auf die Popularphilosophen Feder, Garve, Tiedemann, der Wolfianer Eberhard, Herder, dessen „Metakritik“ (Leipz. 1799) und „Kalligone“ (Berl. 1800) weniger Beachtung fanden, als sie verdienten, der „Glaubensphilosoph“ Jacobi und der Skeptiker G. E. Schulze („Änesidemus“, Helmst. 1792), Sal. Maimon, Beck, Bardili u. a. Als Anhänger Kants machten sich außer Reinhold zuerst Joh. Schultz (durch „Erläuterungen zu Kants Kritik“, Königsb. 1784, welche dessen vollen Beifall fanden), Jakob, Erhard Schmid, auf dem Gebiet der Religionsphilosophie: Heidenreich, Tieftrunk, Wegscheider u. a., auf dem der Logik: Kiesewetter, Hoffbauer, Krug, Maaß, Fries, auf dem der Psychologie: Maaß, Fries, auf dem der Ästhetik: Schiller, Bouterwek, auf dem der Geschichte der Philosophie: Tennemann, Buhle, Wendt u. a. bemerklich. Indirekt sind fast alle nach K. Philosophierenden durch ihn beeinflußt worden, indem nicht nur Fichte, der Urheber der idealistischen Richtung, sich anfänglich selbst für einen Kantianer hielt, sondern auch Herbart, der Urheber der realistischen Strömung, sich selbst einen Kantianer „vom Jahr 1828“ nannte, Schopenhauer von allen seinen Vorgängern nur K. als seinen Lehrer anerkannte. Eine Geschichte der Kantschen Philosophie hat Rosenkranz im 12. Band seiner Ausgabe der Kantschen Werke geliefert. Nach der Abwendung von der Hegelschen Schule und dem Mißerfolg der positiven Philosophie Schellings kehrte das philosophische Interesse vielfach zu K. als dem ursprünglichen Ausgangspunkt der neuern deutschen Philosophie zurück, und es begann ein erneuertes, zum Teil philologisch vertieftes Studium seiner Werke. Eine Reaktion zu gunsten der Kantschen idealistischen Erkenntnistheorie ging von den Naturforschern, insbesondere von den Physiologen aus der Schule des eifrigen Verehrers Kants, Johannes Müller, aus, an welcher Helmholtz, Rokitansky, Wundt, Czermak u. a. sich beteiligten. Gegenwärtig ist das Studium, die Erläuterung und Erneuerung Kants an der Tagesordnung, wie die zahlreichen neuesten Schriften, hauptsächlich über dessen Erkenntnistheorie, von Montgomery, Cohen, Paulsen, R. Zimmermann, Stadler, Röder, Weber, Hölder, Volkelt, Thiele, Laas, Frederichs, Zeller, Pünjer, Witte u. a. und der von Vaihinger zur Säkularfeier der „Kritik der reinen Vernunft“ begonnene „Kommentar“ (Stuttg. 1881 ff.) beweisen. Vgl. über Kants Philosophie Chalybäus, Historische Entwickelung der spekulativen Philosophie von K. bis Hegel (Leipz. 1837, 5. Aufl. 1860); I. H. ^[Immanuel Hermann] Fichte, Beiträge zur Charakteristik der neuern Philosophie (Sulzb. 1829, 2. Aufl. 1841); Kuno Fischer, Immanuel K. (Mannh. 1860, 2 Bde.; 3. Aufl., Münch. 1883; nach Erdmanns Urteil die „beste Monographie“ über K., womit jedoch das Urteil Trendelenburgs: „Kuno Fischer und sein K.“ und Fischers Gegenschrift: „Anti-Trendelenburg“ [Jena 1870] zu vergleichen). Über seine Schule vgl. außer obigem Werk von Rosenkranz noch: Mirbt, K. und seine Nachfolger (Jena 1841, Bd. 1); K. Fischer, Die zwei Kantschen Schulen zu Jena (Stuttg. 1862); Liebmann, K. und die Epigonen (das. 1865); B. Erdmann, Kants Kritizismus in der 1. und 2. Auflage der „Kritik der reinen Vernunft“ (Leipz. 1878); „Kants Reflexionen zur kritischen Philosophie“, aus Kants handschriftlichen Aufzeichnungen herausgegeben von B. Erdmann (das. 1882-85, Bd. 1 u. 2); von außerdeutschen Stimmen: Villers, La philosophie de K. (Metz 1801); Cousin, Leçons sur la philosophie de K. (4. Aufl., Par. 1864); Destouit, La philosophie de K. (das. 1875); Caird, Critical account of the philosophy of K. (Lond. 1877); Adamson, Philosophy of K. (das. 1879; deutsch Leipz. 1880); Cantoni, Emanuele K. (Mail. 1879-84, 3 Bde.).
Meyers Konversations-Lexikon. Eine Encyklopädie des allgemeinen Wissens
4. Auflage, 1885-1892, 16 + 3 Bände, 16.600 Seiten, 200.000 Exemplare